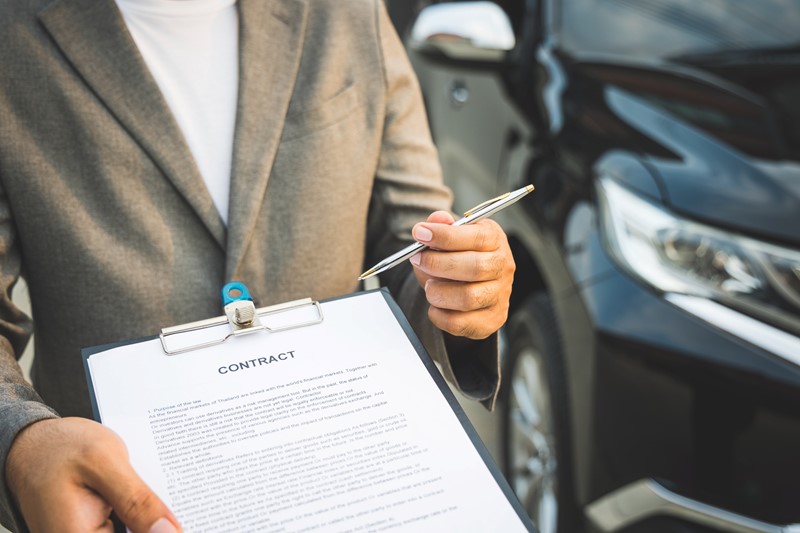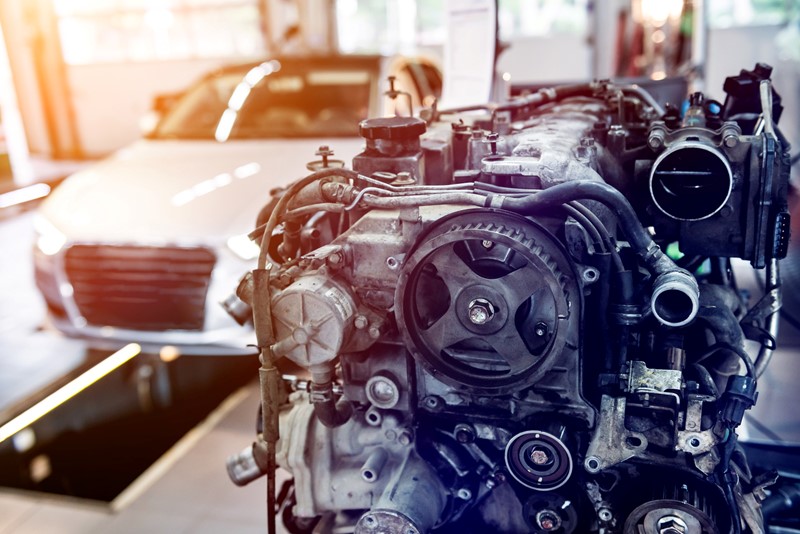Kindergeld: Korrektur wegen Änderung der Verhältnisse
Wenn sich bei einem volljährigen Kind, das sich in einem weiteren Abschnitt der beruflichen Ausbildung befindet, die Erwerbstätigkeit über die Unschädlichkeitsgrenze von 20 Stunden regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit hinaus ausweitet, kann eine Änderung der Verhältnisse vorliegen, die eine Korrektur nach § 70 Abs. 2 Satz 1 EStG rechtfertigt.
Praxis-Beispiel:
Ursprünglich hatte die Familienkasse das Kindergeld im Hinblick auf die vom Kind abgeschlossene Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement bis Januar 2018 gewährt. Im August 2018 stellte die Klägerin einen neuen Kindergeldantrag und gab an, Ihr Kind werde ab dem Wintersemester 2018/2019 ein Vollzeitstudium der Betriebswirtschaftslehre aufnehmen (vgl. Studienbescheinigung vom 23.08.2018). Er übe eine Erwerbstätigkeit mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 19,25 Stunden aus. Die Familienkasse bewilligte das Kindergeld ab April 2018.
Mit Schreiben vom 4.10.2018 teilte die Klägerin mit, dass sich der Studiengang geändert habe und sich daraus eine neue wöchentliche Arbeitszeit ergebe (ab 01.10.2018: 23,1 Stunden pro Woche). Im Februar 2021 übersandte die Klägerin der Familienkasse eine Immatrikulationsbescheinigung der Hochschule vom 18.01.2021, nach der ihr Kind dort seit dem 1.9.2018 ununterbrochen für den Teilzeit-Studiengang “Business Administration” eingeschrieben war. Sie gab an, dass sich die Erwerbstätigkeit ihres Kindes seit März 2020 auf 24 Stunden pro Woche erhöht habe.
Die Familienkasse hob die Festsetzung des Kindergelds für den Zeitraum von Oktober 2018 bis Juni 2022 auf und forderte einen für diesen Zeitraum überzahlten Betrag zurück. Nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhob die Klägerin Klage zum Finanzgericht. Während des Klageverfahrens hob die Familienkasse den angefochtenen Bescheid für den Zeitraum von Oktober 2018 bis Dezember 2018 wegen Festsetzungsverjährung auf.
Das Finanzgericht hat zu Unrecht entschieden, dass der Aufhebungs- und Rückforderungsbescheid rechtswidrig sei, weil es an einer Korrekturvorschrift fehle. Mit der Erhöhung der Wochenarbeitszeit von 19,25 auf 23,1 Stunden ab Oktober 2018 ist nach der Bekanntgabe der Kindergeldfestsetzung vom 3.9.2018 eine wesentliche Änderung eingetreten. Es handelt sich um eine für den Kindergeldanspruch erhebliche Änderung der Verhältnisse, wenn ein volljähriges Kind seine Erwerbstätigkeit nach abgeschlossener Erstausbildung über die Unschädlichkeitsgrenze von 20 Stunden hinaus ausweitet, sodass eine Korrektur nach § 70 Abs. 2 Satz 1 EStG zulässig ist.
Aber! Das Finanzgericht hat mit seinen Ausführungen zum Bestehen des zeitlichen und sachlichen Zusammenhangs der kaufmännischen Ausbildung mit dem Teilzeitstudium im Fach Business Administration ein Argument angeführt, das aus seiner Sicht offenbar gegen eine einheitliche Erstausbildung sprach bzw. eine solche jedoch im Gegenteil als durchaus möglich erscheinen lässt. Ein Teilzeitstudium neben einer Teilzeiterwerbstätigkeit schließt eine einheitliche mehraktige Erstausbildung nicht von vornherein aus, vielmehr bedarf es einer umfassenden Würdigung aller Einzelfallumstände. Die bisherigen Feststellungen des Finanzgerichts reichen nicht für eine abschließende Würdigung aus.
Fazit: Die Sache ist nicht spruchreif. Der BFH hat den Fall an das Finanzgericht zurückgegeben, um die Sachverhalte zu klären.
Aktivrente: Was seit dem 1.1.2026 gilt
Die Aktivrente ist keine Rente, sondern ein Steuerfreibetrag, nach dem Arbeitslohn bis zu 2.000 € im Monat steuerfrei ist. Der Freibetrag kann in Anspruch genommen werden kann, wenn jemand
- die Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung bereits erreicht hat und
- sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist.
Die Regelung ist am 1. Januar 2026 in Kraft getreten. Sie ist erstmals auf den laufenden Arbeitslohn anzuwenden, der für einen nach dem 31. Dezember 2025 endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf sonstige Bezüge (Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Bonus u.ä.), die nach dem 31. Dezember 2025 zufließen.
Hinweis: Wenn die Aktivrente bisher bei Gehaltsabrechnungen noch nicht berücksichtigt wurde bzw. werden konnte, kann dies nachträglich korrigiert werden.
Begünstigt sind unbeschränkt und beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer, die:
- Ihre gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht haben (67 Jahre inkl. Übergangsregelung gem. § 35 Satz 2 oder § 235 des SGB VI) und
- nichtselbständig beschäftigt sind (§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG) und
- für deren Arbeitslohn der Arbeitgeber Rentenversicherungsbeiträge oder Beitragszuschüsse zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen zu entrichten hat (§ 168 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 1d oder Absatz 3, § 172 Absatz 1 oder § 172a SGB VI).
Dies gilt unabhängig davon, welche Art der Erwerbstätigkeit (nichtselbständig, verbeamtet, selbständig etc.) bisher ausgeübt worden ist. Entscheidend für die Aktivrente ist nur die aktuell ausgeübte Tätigkeit. Die Steuerbefreiung gilt insbesondere nicht für Einnahmen aus anderen Erwerbstätigkeiten, z. B.:
- aus selbständigen Tätigkeiten
- aus einem Beamtenverhältnis
- als Abgeordneter
- aus Minijobs (geringfügige Beschäftigung)
Der Status im Rahmen der Krankenversicherung (pflichtversichert, freiwillig gesetzlich versichert, privat versichert) ist unmaßgeblich. Auch bei geschäftsführenden Gesellschaftern einer Kapitalgesellschaft ist die Inanspruchnahme der Aktivrente davon abhängig, ob Rentenversicherungsbeiträge im oben genannten Sinne abgeführt werden müssen.
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Aktivrente beim Lohnsteuerabzug zu berücksichtigen. Er hat den Lohnsteuerabzug entsprechend den gesetzlichen Vorgaben vorzunehmen, dazu gehört auch die Berücksichtigung des Freibetrags aus der Aktivrente im Lohnsteuerabzugsverfahren.
Fazit: Die Aktivrente (= Freibetrag von 2.000 € pro Monat) kann auch von Ruhestandsbeamten ab dem Erreichen der gesetzlichen Regelaltersgrenze beansprucht werden, wenn sie sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Die Steuerbefreiung kann also Anwendung finden, wenn der Arbeitgeber nach § 172 Absatz 1 SGB VI für das aktive Beschäftigungsverhältnis Rentenversicherungsbeiträge abzuführen hat.
Die Aktivrente kann nur genutzt werden, wenn Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19 EStG) erzielt werden. Die Steuerfreistellung nach § 3 Nr. 21 EStG richtet sich ausschließlich nach steuerrechtlichen Kriterien. Die sozialversicherungsrechtliche Einordnung einer Tätigkeit ist für die steuerrechtliche Beurteilung nicht maßgebend.
Fazit: Wer bisher selbständig tätig war, kann die „Aktivrente“ erhalten, wenn er die gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht hat und eine nichtselbständige sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausübt. Entscheidend für die Aktivrente ist nur die aktuell ausgeübte Tätigkeit.
Aktivierung einer Instandhaltungsrückstellung
Ein bilanzierender Gewerbetreibender, der Eigentümer einer Eigentumswohnung ist und der Zahlungen in eine von der Wohnungseigentümergemeinschaft gebildete Instandhaltungsrückstellung geleistet hat, muss seine Beteiligung an der Instandhaltungsrückstellung, trotz der Änderungen des Wohnungseigentumsgesetzes durch das Gesetz zur Änderung des Wohnungseigentumsgesetzes und anderer Gesetze vom 26.03.2007, mit dem Betrag der geleisteten und noch nicht verbrauchten Einzahlungen aktivieren.
Praxis-Beispiel:
Streitig ist, ob ein bilanzierender Gewerbetreibender, dem eine Eigentumswohnung gehört und der Zahlungen in eine von der Wohnungseigentümergemeinschaft gebildete Instandhaltungsrückstellung im Sinne des § 28 Abs. 1 Nr. 3 der bis 30.11.2020 geltenden Fassung des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) geleistet hat, im Jahr 2016 (Streitjahr) seine Beteiligung an der Instandhaltungsrückstellung mit dem Betrag der geleisteten und noch nicht verbrauchten Einzahlungen aktivieren muss.
Das zuständige Finanzamt setzte für die erworbenen Teileigentumsrechte Grunderwerbsteuer in Höhe von 2.600 € auf Basis einer Bemessungsgrundlage von 40.000 € fest. Mit dem hiergegen gerichteten Einspruch machte die Klägerin geltend, die Bemessungsgrundlage müsse um die miterworbenen Guthaben aus der Instandhaltungsrückstellung von insgesamt 14.815,19 € vermindert und die Grunderwerbsteuerfestsetzung gemäß § 3 Nr. 1 des Grunderwerbsteuergesetzes aufgehoben werden, da der auf die erworbenen Teileigentumsrechte entfallende Kaufpreis nach Abzug der Instandhaltungsrückstellung den Betrag von 2.500 € je Teileigentum nicht übersteige. Der Einspruch wurde als unbegründet zurückgewiesen.
Auch ein bilanzierender Gewerbetreibender darf die von ihm in eine Instandhaltungsrückstellung geleisteten Zahlungen nicht (sofort) als Betriebsausgaben abziehen. Denn die Überlegung, die im Bereich der Überschusseinkünfte zur Versagung des Werbungskostenabzugs führt, gilt für die Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich gleichermaßen. Die Zahlungen sind zunächst erfolgsneutral zu behandeln.
Entgegen der Ansicht der Klägerin ergibt sich aus der grunderwerbsteuerrechtlichen Beurteilung der Instandhaltungsrückstellung nichts anderes. Die grunderwerbsteuerliche Bemessungsgrundlage (Kaufpreis) ist nicht um den auf den Erwerber – wirtschaftlich – entfallenden Anteil an der Instandhaltungsrückstellung zu mindern, weil ein zu besteuernder Rechtsträgerwechsel hinsichtlich der Instandhaltungsrückstellung nicht stattgefunden hat. Es handelt sich um Vermögen der Wohnungseigentümergemeinschaft, nicht aber um das anteilige Vermögen der einzelnen Gemeinschafter. Das Einkommensteuerrecht stellt regelmäßig auf wirtschaftliche Vorgänge ab. Eine deckungsgleiche Beurteilung vergleichbarer Vorgänge im Grunderwerbsteuerrecht und im Einkommensteuerrecht ist daher von vornherein nicht geboten
Der BFH weist darauf hin, dass auch die zum 1.12.2020 in Kraft getretene Reform des Wohnungseigentumsgesetzes durch das Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz an der ertragsteuerlichen und somit auch an der grunderwerbsteuerlichen Beurteilung nichts ändert.
Anschaffungskosten oder Erhaltungs- und Instandhaltungs-aufwendungen
Anschaffungskosten werden über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Bei Gebäuden ist die Abschreibung und damit auch die Nutzungsdauer durch gesetzlich festgelegte Prozentsätze festgelegt. Erhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen können hingegen sofort in voller Höhe abgeschrieben werden. Die Zuordnung zu den Instandhaltungsaufwendungen oder Anschaffungskosten hat also beachtliche Auswirkungen. Bei der Anschaffung eines Gebäudes ist innerhalb der ersten 3 Jahre die sogenannte Nichtaufgriffsgrenze von 15% zu beachten.
Praxis-Beispiel:
Ein Unternehmer hat ein Gebäude erworben, das er als Bürogebäude nutzen will. Die Anschaffungskosten haben insgesamt 268.000 € (100%) betragen. Davon entfallen 180.000 € (78,12 %) auf das Gebäude und 88.000 € (21,88%) auf den Grund und Boden.
Der Unternehmer hat im Anschaffungsjahr mit umfangreichen Baumaßnahmen begonnen. Dabei handelt es sich um
- Instandhaltungsarbeiten in Höhe von 18.000 €,
- Baumaßnahmen zur Erweiterung des Gebäudes in Höhe von 24.000 € und
- regelmäßig wiederkehrenden Erhaltungsaufwand für Malerarbeiten in Höhe von 2.000 €.
Die 18.000 € können in vollem Umfang als Grundstücksaufwand erfasst werden. Wenn die Reparatur- und Modernisierungsaufwendungen in den beiden Folgejahren netto ohne Umsatzsteuer nicht mehr als 9.000 € = 5% der Gebäudeanschaffungskosten ausmachen, bleibt es dabei.
Fallen in den beiden Folgejahren Reparatur- und Modernisierungsaufwendungen von mehr als 9.000 € netto ohne Umsatzsteuer an, werden die Instandhaltungskosten von 18.000 € rückwirkend als Herstellungskosten eingestuft. Aufwendungen für die Erweiterung werden bei der Ermittlung der 15% Grenze nicht einbezogen, ebenso wie die Aufwendungen für Erhaltungsarbeiten, die jährlich üblicherweise anfallen.
Was anschaffungsnahe Aufwendungen sind
Die Abgrenzung von Anschaffungskosten, Herstellungskosten und Erhaltungsaufwendungen ent-scheidet darüber, welche Aufwendungen der Unternehmer sofort und welche er nur im Rahmen der Abschreibung geltend machen kann. Anschaffungskosten eines Gebäudes sind die Aufwendungen, die geleistet werden, um das Gebäude zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Diese Definition gilt unabhängig von der Art der Gewinnermittlung.
Ein Gebäude ist betriebsbereit, wenn es entsprechend seiner Zweckbestimmung genutzt werden kann. Die Betriebsbereitschaft eines Gebäudes setzt eine
- objektive und
- subjektive
Funktionstüchtigkeit voraus. Sind wesentliche Teile eines Gebäudes nicht nutzbar, z. B. weil die Elektroinstallation völlig unbrauchbar ist, gehören die Reparaturkosten unabhängig von ihrer Höhe zu den Anschaffungskosten. Werden dagegen noch funktionierende Anlagen erneuert, handelt es sich um Erhaltungsaufwendungen.
Ein Gebäude ist subjektiv funktionsuntüchtig, wenn der Unternehmer es ohne Baumaßnahmen nicht für seinen konkreten Zweck nutzen kann. Baumaßnahmen, die er zur zweckentsprechenden Nutzung aufwendet, gehören zu den Anschaffungskosten, z. B. wenn
- ein Gebäude als Büro genutzt werden soll, die Elektroinstallation aber für Wohnzwecke und nicht für Bürozwecke geeignet ist,
- Büroräume, die bisher von einem Rechtsanwalt genutzt wurden, umgebaut werden, damit sie als Zahnarztpraxis genutzt werden können.
Diese Umbauaufwendungen gehören zu den Anschaffungskosten und werden zusammen mit diesen abgeschrieben. Die 15%-Grenze des § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle.
Unternehmer: Fahrten zwischen Wohnung und erster Betriebsstätte
Übt der Unternehmer seine Tätigkeit im häuslichen Arbeitszimmer aus oder hat er mehrere Betriebsstätten bzw. mehrere Büros, stellt sich immer die Frage, bei welchen Fahrten es sich um auswärtige Tätigkeiten oder um Fahrten zwischen Wohnung und erster Betriebsstätte handelt, bei denen nur die Entfernungspausschale angesetzt werden darf. Die Regelungen für Arbeitnehmer gelten laut BMF sinngemäß auch für Unternehmer.
Praxis-Beispiel:
Bei zwei Betriebsstätten gibt es nur eine erste Betriebsstätte. Ein Unternehmer, der in Bonn eine Betriebsstätte hat (Entfernung 22 km) unterhält außerdem noch im 14 km entfernten Bad Godesberg eine weitere Betriebsstätte. Er fährt mit seinem Firmenwagen (Bruttolistenpreis 50.000 €) an 3 Tagen in der Woche zur 22km entfernten Betriebsstätte in Bonn. An zwei Tagen in der Woche fährt er zur 14 km entfernten Betriebsstätte in Bad Godesberg.
Fazit: Die Filiale in Bad Godesberg ist die erste Betriebsstätte, weil sie näher zur Wohnung liegt. Die Filiale in Bonn ist keine erste Betriebsstätte, sodass es sich bei den Fahrten dorthin um eine auswärtige Tätigkeit handelt.
Berechnung ab 2026 für die Fahrten zur 14 km entfernt liegenden ersten Betriebsstätte:
| Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb: 50.000 € × 0,03% × 14 km × 12 Monate = |
2.520,00 € |
| abzüglich Entfernungspauschale von 14 km × 0,38 € × 96 Tage |
– 510,72 € |
| = nicht abziehbare Betriebsausgaben |
2.009,28 € |
Die Entfernungspauschale wird nur für die Fahrten zur ersten Betriebsstätte angesetzt. Das bedeutet, dass die Fahrten nach Bonn als auswärtige Tätigkeiten einzustufen sind, sodass die Kosten für diese Fahrten uneingeschränkt abziehbar sind. Sind alle Fahrtkosten, wie Abschreibung, Benzin, Reparaturen, Versicherungen usw. bereits in der Buchführung erfasst, kann der pauschal ermittelte Teil der nicht abziehbaren Kosten wie folgt gebucht werden:
„Unentgeltliche Wertangaben 2.009,28 € an
Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte und Familienheimfahrten (Haben) 2.009,28 €“.
Der Unternehmer darf, anstelle der Entfernungspauschale, nicht die tatsächlichen Kfz-Kosten oder die Reisekostenpauschale von 0,30 € je gefahrenem Km ansetzen.
Die Entfernungspauschale lag bis zum 31.12.2025 bei: 0,30 € für Entfernungen bis zu 20 km und 0,38 € ab dem 21. Entfernungskilometer.
Seit dem 1.1.2026 gilt ab dem 1. Entfernungskilometer die einheitliche Entfernungspauschale von 0,38 € (das gilt auch für Familienheimfahrten im Rahmen der doppelten Haushaltsführung).
Anwendung der pauschalen 0,03% Regelung: Werden die Privatfahrten mit dem Firmen-Pkw pauschal mithilfe der 1%-Regelung ermittelt, müssen die nicht abziehbaren Kosten, die auf Fahrten zwischen Wohnung und erster Betriebsstätte entfallen, ebenfalls pauschal ermittelt werden. Der Betrag wird pauschal mit 0,03% des inländischen Bruttolistenpreises je Kalendermonat berechnet. Anders als bei Arbeitnehmern lässt der BFH die pauschale Ermittlung mit 0,002% vom Bruttolistenpreis des Fahrzeugs je Entfernungskilometer für jede Fahrt zur ersten Betriebsstätte (maximal einmal pro Tag) nicht zu.
Überlässt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer einen Firmenwagen, versteuert er den geldwerten Vorteil für Privatfahrten regelmäßig nach der 1%-Methode. Als Ausgleich für die nicht abziehbaren Kosten bei Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte erfasst er bei seinem Arbeitnehmer als Arbeitslohn entweder
- pauschal 0,03% vom Bruttolistenpreis des Fahrzeugs je Entfernungskilometer pro Monat (die 0,03%-Reglung geht von 15 Fahrten pro Monat aus) oder
- pauschal 0,002% vom Bruttolistenpreis des Fahrzeugs je Entfernungskilometer für jede Fahrt zum Betrieb (maximal einmal pro Tag).
Grunderwerbsteuer: Anzeigepflicht eines Notars
Notare sind nach dem Grunderwerbsteuergesetz (§ 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GrEStG) verpflichtet, Verträge, die den Verkauf eines inländischen Grundstücks betreffen, innerhalb von zwei Wochen ab Beurkundung der Grunderwerbsteuerstelle des zuständigen Finanzamts anzuzeigen. Parallel und unabhängig von der Anzeigepflicht des Notars müssen auch die Vertragsparteien als Schuldner der Grunderwerbsteuer den Grundstücksvertrag dem Finanzamt anzeigen (§ 19 GrEStG).
Kommt ein Notar seiner Pflicht zur Anzeige nicht innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Zwei-Wochen-Frist nach, kann er keinen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 110 der Abgabenordnung (AO) stellen.
Praxis-Beispiel:
Die Klägerin (Notarin) beurkundete einen Erbauseinandersetzungsvertrag zwischen Geschwistern (den Klägern in den Verfahren II R 20/23 und 21/23). Zum Nachlass gehörten GmbH-Beteiligungen, die über inländischen Grundbesitz verfügten. Die Notarin zeigte die Beurkundung beim Finanzamt an, jedoch nicht rechtzeitig innerhalb der zweiwöchigen Frist. Ebenso wenig erfolgte eine rechtzeitige Anzeige durch die Geschwister. In der Folge machten die Geschwister die Erbauseinandersetzung wieder rückgängig. Daran schloss sich die Frage an, ob die für den Erbauseinandersetzungsvertrag entstandene Grunderwerbsteuer wegen der Rückabwicklung nicht festgesetzt werden könnte. Voraussetzung für die Nichtfestsetzung wäre unter anderem gewesen, dass der Erbauseinandersetzungsvertrag dem Finanzamt innerhalb der zweiwöchigen Frist angezeigt worden wäre, wobei eine rechtzeitige Anzeige durch die Notarin hier zugunsten der Geschwister hätte wirken können. Die Notarin stellte deshalb beim Finanzamt einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 110 AO hinsichtlich der notariellen Anzeigefrist. Der Antrag wurde durch das Finanzamt abgelehnt. Auch das Finanzgericht gewährte der Notarin keine Wiedereinsetzung.
Der BFH schloss sich der Auffassung des Finanzgerichts an. Die Notarin kann einen solchen Antrag nicht stellen, weil sie nicht „jemand“ i.S. des § 110 Satz 1 AO ist. Zum Kreis der antragsberechtigten Personen zählen nur die am Grunderwerbsteuerverfahren beteiligten Steuerpflichtigen – im Streitfall die Geschwister. Nur diese können im Hinblick auf die von ihnen versäumte Frist nach § 19 GrEStG einen Antrag auf Wiedereinsetzung stellen. Der Notar hingegen ist am Grunderwerbsteuerverfahren nicht beteiligt. Er erfüllt mit der Anzeige nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GrEStG seine eigene Pflicht gegenüber dem Finanzamt.
Konsequenz: Der Notar haftet in diesem Fall nicht für ein Versäumnis – weder gegenüber den Steuerpflichtigen noch gegenüber dem Finanzamt.
Wichtig! Steuerpflichtige sollten ihre eigene Anzeigepflicht nach § 19 GrEStG kennen und beurkundete Grundstücksverträge rechtzeitig selbst und unabhängig von der Anzeige des Notars dem Finanzamt mitteilen.
Geringwertiges Wirtschaftsgut durch Investitionsabzugsbetrag
Durch Bildung und Auflösung eines Investitionsabzugsbetrags kann ein geringwertiges Wirtschaftsgut entstehen.
Praxis-Beispiel:
Ein Unternehmer hat 2024 für die Anschaffung eines Aktenschranks einen Investitionsabzugsbetrag gebildet (voraussichtliche Anschaffungskosten von 1.200 € (netto) × 50% = 600 €). Er schafft den Aktenschrank am 3.1.26 für brutto 1.428 € an. Er rechnet wie folgt:
| Bruttobetrag |
1.428,00 € |
| abzüglich Umsatzsteuer (Vorsteuer) |
228,00 € |
| Nettobetrag |
1.200,00 € |
| abzüglich Investitionsabzugsbetrag |
600,00 € |
| maßgebende Anschaffungskosten |
600,00 € |
Konsequenz: Die Anschaffungskosten überschreiten nicht den geltenden Grenzwert von 800 €, sodass der Unternehmer den Aktenschrank sofort als geringwertiges Wirtschaftsgut abschreiben darf.
Es dürfen nur bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens als geringwertige Wirtschaftsgüter behandelt werden. Unbewegliche Wirtschaftsgüter, wie z. B. Gebäudeteile, An- und Ausbauten, Platzbefestigungen, Ladeneinbauten, und immaterielle Wirtschaftsgüter dürfen nicht einbezogen werden. Ausnahme: Software, die netto ohne Umsatzsteuer nicht mehr als 800 € kostet, wird als bewegliches (materielles) Wirtschaftsgut behandelt. Nur selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter dürfen sofort abgeschrieben werden. Damit scheiden die Wirtschaftsgüter aus, die nur zusammen mit anderen Wirtschaftsgütern genutzt werden können.
Wichtig: Softwareprodukte sind in der Regel als immaterielle Wirtschaftsgüter einzustufen, sodass eine Zuordnung zu den geringwertigen Wirtschaftsgütern ausscheidet. Allerdings lässt R 5.5 Abs 1 EStR eine Ausnahme bei Trivialsoftware zu: Software bis zum Grenzwert von 800 € wird als materielles Wirtschaftsgut eingestuft.
Internetblogger: Behandlung freiwilliger Zahlungen
Das Finanzgericht hat entschieden, dass freiwillige Zahlungen, die ein Blogger für seinen Internetblog zu tagesaktuellen Themen erhält, den Einnahmen als Journalist (oder jedenfalls eines ähnlichen Berufs) zuzuordnen sind.
Ausgangsbetrachtung:
Grundlage für die Feststellung, ob freiwillige Zahlungen für das Bloggen als journalistische oder eine vergleichbare berufliche Tätigkeit gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG Betriebseinnahmen sind, richtet sich danach, ob der Blogger als Teilnehmer am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr anzusehen ist, bei dem seine Beiträge, auch wenn sie frei zugänglich sind, eine wirtschaftliche Gegenleistung darstellen, die durch die Zahlungen der Leser vergütet wird.
Die freiwilligen Zahlungen der Leser werden nach Auffassung des Finanzgerichts als Betriebseinnahmen betrachtet, da eine klare Verknüpfung zwischen der Zahlung und den veröffentlichten Inhalten des Blogs besteht. Die Tatsache, dass diese Zahlungen freiwillig und nicht rechtlich verpflichtend sind, spielt dabei keine Rolle. Das Finanzgericht betont, dass eine vertragliche Bindung oder ausdrückliche Zahlungsverpflichtung zwischen dem Blogger und den Lesern nicht notwendig ist, um eine Teilnahme am wirtschaftlichen Verkehr anzunehmen. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass der Blogger bewusst Maßnahmen ergreift, um die Zahlungen der Leser zu fördern, beispielsweise durch die Darstellung von Spendenmöglichkeiten und die Betonung der finanziellen Voraussetzungen des Blogs. Dies deutet eindeutig auf eine Gewinnerzielungsabsicht hin.
Das Finanzgericht betrachtete daher die Änderungen der Einkommensteuerbescheide für die Jahre 2017 bis 2019 als rechtmäßig, weil die Art der Tätigkeit und die erhaltenen Zahlungen die gesetzlichen Kriterien für selbständige und journalistische Arbeit erfüllen und somit steuerpflichtig sind.
Hinweis: Gegen das Urteil des Finanzgerichts ist Revision eingelegt worden (Az. des BFH: VIII R 18/25). In vergleichbaren Fällen ist es daher sinnvoll, Einspruch gegen die Steuerfestsetzung einzulegen und zu beantragen, das Einspruchsverfahren bis zur Entscheidung durch den BFH ruhen zu lassen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter: was zu beachten ist
Bei der Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern kann der Unternehmer (auch handelsrechtlich) zwischen 3 Varianten wählen. Ist der Unternehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt, können die Wirtschaftsgüter mit den Netto-Anschaffungs- oder Herstellungskosten wie folgt erfasst werden:
- bis zu 250 €: Erfassung als Sofortaufwand oder als “geringwertiges Wirtschaftsgut”
- von 250 € bis 800 €: auf das Konto “Geringwertige Wirtschaftsgüter” oder alternativ
- bei mehr als 250 € und weniger als 1.000 €: auf das Konto “Wirtschaftsgüter (Sammelposten)”
Ob ein geringwertiges Wirtschaftsgut vorliegt, hängt von der Höhe der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und außerdem davon ab, ob die Wirtschaftsgüter beweglich, abnutzbar und selbständig (= für sich allein) nutzbar sind. Die Anschaffung- oder Herstellungskosten dürfen netto ohne Umsatzsteuer
- nicht über 800 € bzw.
- zwischen 250 € und 1.000 € liegen, wenn sie in einen Sammelposten eingestellt werden sollen.
Maßgebend ist immer der Nettobetrag, unabhängig davon, ob die Umsatzsteuer in vollem Umfang, teilweise oder überhaupt nicht als Vorsteuer abgezogen werden kann.
Praxis-Beispiel:
Ein Arzt, der ausschließlich umsatzsteuerfreie Umsätze ausführt, kauft eine Büroleuchte für 800 € zuzüglich 19% Umsatzsteuer von 152 € (brutto also 952 €). Konsequenz: Da es auf den Nettobetrag ohne Umsatzsteuer ankommt, überschreitet der Arzt nicht den Grenzwert von 800 €. Er kann somit den Betrag von 952 € sofort zu 100% abschreiben, obwohl die Anschaffungskosten wegen des fehlenden Vorsteuerabzugs den Betrag von 800 € übersteigen.
Beim Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter sollte auf detaillierte Rechnung geachtet werden. Kauft ein Unternehmer verschiedene Gegenstände, muss eine detaillierte Rechnung ausgestellt werden, weil nur so dokumentiert werden kann, welcher Gegenstand den Grenzwert nicht überschreitet. Hinweis: Sollte es nicht möglich sein, eine detaillierte Rechnung zu erhalten, kann der Gesamtbetrag auch nach Verkaufsunterlagen (z. B. Prospekt mit Preisangaben) aufgeteilt werden. Diese Unterlagen müssen zusammen mit der Rechnung aufbewahrt werden.
Bei der Beurteilung, ob der Grenzwert überschritten wird, ist nicht allein der Kaufpreis maßgebend. Zu den Anschaffungskosten gehören zusätzlich alle Aufwendungen, die der Unternehmer leistet, um den Gegenstand
- zu erwerben und
- in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, wie z. B. Transportkosten, Verpackungskosten und Montagekosten.
Nicht dazu gehören Kosten, die im Zusammenhang mit der Zahlung stehen, z. B. Nachnahme- oder Mahngebühren. Bestellt ein Unternehmer mehrere Wirtschaftsgüter und zahlt er einen pauschalen Betrag für Transport und Verpackung, dann muss er diesen anteilig auf alle Wirtschaftsgüter verteilen. Skonti und Rabatte mindern die Anschaffungskosten, sodass der geminderte Betrag für die Beurteilung maßgebend ist. Wird das Wirtschaftsgut vor dem Jahreswechsel gekauft und erst im neuen Jahr unter Abzug eines Skontoabzugs bezahlt, wirkt sich diese Kaufpreisreduzierung nicht mehr im abgelaufenen Jahr aus.
Praxis-Beispiel:
Ein Unternehmer schafft Ende Dezember 2025 ein Wirtschaftsgut für netto 812 € an und zahlt den Kaufpreis erst am 3.1.2026 unter Abzug von 2% Skonto (= 16,24 €). Im Jahr 2025 ist der Betrag von 812 € maßgebend. Es handelt sich dann nicht um ein geringwertiges Wirtschaftsgut. Der Unternehmer muss das Wirtschaftsgut über die Nutzungsdauer abschreiben bzw. in den Sammelposten einstellen.
Hat der Unternehmer einen nur steuerlich zulässigen Investitionsabzugsbetrag gebildet, kann dies zu einer Minderung der Anschaffungs- und Herstellungskosten führen, soweit dieser im Investitionsjahr aufzulösen ist. Für steuerliche Zwecke muss der Unternehmer die Gewinnerhöhung wieder rückgängig machen, indem er den Investitionsabzugsbetrag von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzieht. Durch den Abzug des Investitionsabzugsbetrags können (nur steuerlich) geringwertige Wirtschaftsgüter entstehen.
Verkäufe über eBay und andere Online-Handelsplattformen
Unternehmer, die Waren über eine Online-Handelsplattform veräußern, sollten sich unbedingt die allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Handelsplattform ansehen, weil es bei der Abwicklung von Verkäufen unterschiedliche Varianten gibt.
Die Online-Handelsplattformen
- berechnen entweder Gebühren oder
- vereinbaren eine Rabattregelung, wonach der Unternehmer seine Waren mit einem Rabatt der Handelsplattform in Rechnung stellt, sobald der Verkauf über die Online-Plattform erfolgt ist.
Zahlt der Unternehmer monatliche oder verkaufsabhängige Gebühren, handelt es sich um eine Verkaufsprovision, die mit dem Verkaufserlös der Waren verrechnet wird, wenn die Abrechnung über die Online-Handelsplattform erfolgt. D.h., der Unternehmer muss den ungeminderten Betrag als Bruttoerlös erfassen. Die Gebühren sind als Betriebsausgaben (Vermittlungsprovision) zu erfassen. Fazit: Erfasst der Unternehmer nur den Betrag, der nach der Verrechnung überwiesen wird, weist er den Erlös zu niedrig aus.
Achtung: Ist das Unternehmen in einem anderen EU-Land ansässig, schuldet der deutsche Unternehmer ggf. die Umsatzsteuer gem. § 13b UStG, die auf die Vermittlungsprovision entfällt. Die Steuerschuldnerschaft muss dann vom Geschäftspartner übernommen werden.
Praxis-Beispiel:
Ein Unternehmer verkauft Waren über eine Handelsplattform (z. B. über eBay) für insgesamt 119.000 €. Nach Abzug der Gebühren von 10.000 € erhält er einen Betrag von 109.000 €. Wenn er die Umsätze mit (109.000 € × 100/119 =) 91.596 € erfasst und die Umsatzsteuer mit 17.403 € (91.596 € × 19%), dann ist dies unzutreffend. Richtig ist, dass die Bemessungsgrundlage 100.000 € beträgt (= Betrag vor der Verrechnung), weil die Verrechnung mit den Gebühren den Erlös nicht mindert. Der Unternehmer schuldet eine Umsatzsteuer in Höhe von (100.000 € × 19% =) 19.000 €.
Hinweis: Erfolgt die Zahlungsabwicklung z. B. über PayPal, sind diese Gebühren als “Nebenkosten des Geldverkehrs” zu erfassen. D.h., diese Gebühren mindern nicht den Betrag, der als Erlös zu erfassen ist. Ist eine Rabattregelung vereinbart (wie z. B. bei den Artikeln, die unmittelbar von Amazon vertrieben werden), stellt der Unternehmer seine Waren abzüglich eines von vornherein vereinbarten Rabatts in Rechnung, sobald der Verkauf seiner Waren über die Online-Plattform erfolgt ist. Bemessungsgrundlage ist dann der um den Rabatt geminderte Betrag abzüglich Umsatzsteuer.
Praxis-Beispiel:
Ein Verlag überlässt Amazon Bücher, die im Handel (also auch bei Amazon) in Summe mit 1.000 € verkauft werden. Nach den Vereinbarungen zwischen Verlag und Amazon ist ein Rabatt von 50% vereinbart worden. Sind alle Bücher verkauft, sieht die Abrechnung wie folgt aus:
| Bruttopreis der Bücher (inklusive 7% Umsatzsteuer) | 1.000,00 € |
| abzüglich Rabatt (50%) | 500,00 € |
| Erlös brutto | 500,00 € |
| abzüglich Umsatzsteuer (500 : 107 × 7 =) | – 32,71 € |
| Nettoerlös | 467,29 € |
Soweit Skontobeträge einbehalten werden, mindern diese ebenfalls den Umsatz, so dass der Verkaufspreis abzüglich Rabatt und abzüglich Skonto als Erlös zu erfassen ist.
Die Sonderregelung One-Stop-Shop richtet sich an Unternehmer, die im Inland ansässig sind und gegen Entgelt
- Dienstleistungen an Privatpersonen in Mitgliedstaaten der EU erbringen, in denen sie nicht ansässig sind oder
- innergemeinschaftliche Fernverkäufe von Gegenständen tätigen oder
- eine elektronische Schnittstelle zur Verfügung stellen, durch deren Nutzung sie die Lieferung von Gegenständen innerhalb eines Mitgliedstaats durch einen nicht in der Gemeinschaft ansässigen Steuerpflichtigen unterstützen und deshalb behandelt werden, als ob sie die Gegenstände selbst geliefert hätten.
Darüber hinaus richtet sich das Verfahren an Unternehmer, die nicht in der Europäischen Union ansässig sind und im Inland über eine Einrichtung (zum Beispiel ein Warenlager) verfügen, von der aus Waren an Privatpersonen in andere EU-Mitgliedstaaten geliefert werden.
Leasing-Fahrzeug: Zahlungen am Vertragsende
Leasingverträge enthalten in der Regel Vereinbarungen, wonach am Ende eines Leasingvertrags vertraglich festgelegte Zahlungen anfallen können. Das ist z. B. der Fall, wenn das Fahrzeug
- vorzeitig zurückgegeben wird oder
- wenn das Fahrzeug in einem nicht vertragsgemäßen Zustand zurückgegeben wird.
Bei den Zahlungen, die zu leisten sind, kann es sich somit um nicht steuerbaren Schadensersatz oder um ein zusätzliches Nutzungsentgelt oder um eine Minderung des Nutzungsentgelts handeln.
Praxis-Beispiel:
Ein Unternehmer hat mit seinem geleasten Firmenwagen einen Totalschaden erlitten. Seine Versicherung deckt die Schäden bzw. die Wertminderung ab, die am Fahrzeug entstanden sind. Allerdings muss der Unternehmer eine Entschädigung dafür zahlen, dass der Leasingvertrag vorzeitig beendet wird. Das heißt, er zahlt an die Leasinggesellschaft zusätzlich als Ersatz für künftige Leasingraten einen Betrag von 1.500 €. Diese Zahlung ist als echter Schadensersatz anzusehen und unterliegt daher nicht der Umsatzsteuer.
Andere Zahlungen bei Beendigung eines Leasingvertrags
Wird ein Leasingvertrag über ein Firmenfahrzeug beendet, indem das Fahrzeug ohne weitere Zahlungen zurückgegeben wird, ergeben sich keine steuerlichen Probleme. Sind jedoch bei der Beendigung des Leasingvertrags Zahlungen zu leisten, muss zumindest für Zwecke der Umsatzsteuer beurteilt werden, welchen Charakter diese Zahlungen haben. Bei den Zahlungen, die zu leisten sind, kann es sich um
- nicht steuerbaren Schadensersatz,
- zusätzliches Nutzungsentgelt oder
- Minderung des Nutzungsentgelts handeln.
Ein Leasingvertrag kann aufgrund vertraglich vereinbarter Kündigungsrechte vorzeitig beendet werden. Soweit die Leasingverträge für derartige Fälle Zahlungen als Ersatz für künftige Leasingraten vorsehen, handelt es sich um einen echten Schadensersatz. Zahlungen sind grundsätzlich dann nicht umsatzsteuerbar, wenn sie wegen Schäden am Leasingfahrzeug als sogenannter Minderwertausgleich geleistet werden. Durch die Kündigung wird die Hauptleistungspflicht des Leasinggebers (= Nutzungsüberlassung des Firmenwagens) beendet. Die Zahlung, die der Leasingnehmer als Ausgleich für künftige Leasingraten erbringen muss, steht nicht mehr im Austauschverhältnis mit einer Leistung des Leasinggebers. Es liegt somit kein Leistungsaustausch vor.
Zahlt der Leasingnehmer einen Minderwertausgleich wegen Schäden am Leasingfahrzeug, handelt es sich nicht um ein Entgelt für die Nutzungsüberlassung. Es handelt sich somit nicht um einen Leistungsaustausch, der der Umsatzsteuer unterliegt. Er muss vielmehr aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen für den Schaden und seine Folgen einstehen. Es handelt sich um einen Betrag, den der Unternehmer als echten Schadensersatz zahlen muss, sodass keine Umsatzsteuer/Vorsteuer anfällt.
Leasingverträge legen häufig den Umfang der Nutzung fest, z. B. jährliche Nutzung von 15.000 km. Auf dieser Basis ermittelt der Leasinggeber die Höhe der Leasingrate. Für Abweichungen von der vereinbarten Kilometerleistung sind vertraglich festgelegte Ausgleichszahlungen zu leisten. Die Vereinbarungen über die Vergütung für Mehr- und Minderkilometer sind also darauf gerichtet, die Ansprüche aus dem Leasingverhältnis an die tatsächliche Nutzung des Fahrzeugs durch den Leasingnehmer anzupassen. Konsequenz ist, dass
- Zahlungen des Leasingnehmers für Mehrkilometer ein zusätzliches Entgelt und
- Zahlungen des Leasinggebers für Minderkilometer eine Entgeltminderung für die Nutzungsüberlassung darstellen.
Das gilt entsprechend auch für Vergütungen zum Ausgleich von Restwertdifferenzen in Leasingverträgen mit Restwertausgleich. Nutzungsentschädigungen wegen verspäteter Rückgabe des Leasingfahrzeugs stellen keinen Schadensersatz dar, sondern sind Entgelt für die Nutzungsüberlassung des Fahrzeugs zwischen vereinbarter und tatsächlicher Rückgabe des Fahrzeugs.
Betriebliche Gesundheitsförderung
Das Finanzgericht hat entschieden, dass ein mehrwöchiges Gesundheitstraining nicht im ganz überwiegenden eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers liegt, wenn es vorrangig auf die Stärkung individueller Gesundheitskompetenz abzielt und nicht auf spezifisch berufsbedingte Beeinträchtigungen abstellt. Es kommt dann allenfalls die Steuerbefreiung bis zu 600 € nach § 3 Nr. 34 EStG in Betracht.
Praxis-Beispiel:
Der Arbeitgeber bot seinen Arbeitnehmern ein Gesundheitskonzept an, das aus mehreren Modulen bestand. Dabei handelte es sich um eine mehrwöchige Kur mit dem Ziel, dem Teilnehmer im Rahmen einer aktiven Selbstvorsorge durch theoretische und praktische Einheiten einen gesunden Lebensstil näherzubringen. Dies basierte auf den Elementen Bewegungsförderung, gesunde Ernährung und psychische Gesundheit. Das Finanzamt ließ die Aufwendungen nur bis zur Höhe des Freibetrages nach § 3 Nr. 34 EStG (600 €, damals noch 500 €) steuerfrei und setzte den übersteigenden Betrag als steuerpflichtigen Arbeitslohn an. Die Klage des Arbeitgebers blieb ohne Erfolg.
Das Finanzgericht begründete seine Auffassung damit, dass das Gesundheitstraining nicht im ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers steht. Als Ziel des Gesundheitstrainings wird die Stärkung der Gesundheitskompetenz eines jeden Einzelnen und die Anregung einer nachhaltig gesundheitsbewussten Lebensweise angegeben. Schwerpunkt ist damit nicht eine Anleitung zur Veränderung der Verhaltensweise bei Ausübung der betrieblichen Betätigung zur Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsprävention. Vielmehr wird hier ein „ganzheitlich geprägter“ Ansatz verfolgt, der die Stärkung der persönlichen Gesundheitskompetenz eines jeden einzelnen Mitarbeiters im Blick hat und damit nicht auf das betriebliche Zusammenarbeiten und die betriebliche Gemeinschaft gerichtet ist.
Fazit: Leistungen des Arbeitgebers zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes und der betrieblichen Gesundheitsförderung sind bis zu 600 € je Mitarbeiter und Jahr steuer- und sozialversicherungsfrei. Vollkommen steuerfrei sind Gesundheitsleistungen, wenn ein ganz überwiegend eigenbetriebliches Interesse des Arbeitgebers besteht. Entsprechende Leistungen können dann auch einen Wert von mehr als 600 € haben. Der Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 34 EStG gilt aber nur dann, wenn der Arbeitgeber die Leistungen zusätzlich zum arbeitsrechtlich geschuldeten Arbeitslohn gewährt. Falls die Leistungen unter Anrechnung auf den vereinbarten Arbeitslohn oder durch Umwandlung des vereinbarten Arbeitslohns erbracht werden, sind sie nicht steuerfrei.
Praxis-Tipp: Das Finanzgericht hat die Revision zugelassen. Diese wurde auch eingelegt und ist beim BFH unter dem Aktenzeichen „VI R 9/25“ anhängig. In vergleichbaren Fällen sollte also Einspruch eingelegt und ein Ruhen des Verfahrens beantragt werden, bis der BFH entschieden hat.
Kinderbetreuungskosten nur bei Haushaltszugehörigkeit
Unter bestimmten Voraussetzungen können Kinderbetreuungskosten als Sonderausgaben nach § 10 EStG berücksichtigt werden. Abzugsfähig sind insbesondere Aufwendungen für Dienstleistungen zur Betreuung eines Kindes unter 14 Jahren, wenn
- das Kind zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehört,
- der Berechtigte für die Betreuungsaufwendungen eine Rechnung erhalten hat und
- den Betrag nicht bar, sondern durch eine Überweisung auf das Konto des Leistungserbringers zahlt.
Der Sonderausgabenabzug beträgt derzeit 80% der Kinderbetreuungskosten und höchstens 4.800 € pro Jahr (bis zum Veranlagungszeitraum 2024 betrug er zwei Drittel der Aufwendungen und höchstens 4.000 € pro Jahr).
Bereits mit Urteil vom 11.5.2023 hatte der BFH entschieden, dass das Kriterium der Haushaltszugehörigkeit auf einer verfassungsrechtlich zulässigen Typisierung beruht. Die Vorschrift verstößt jedenfalls dann nicht gegen die Steuerfreiheit des Existenzminimums und den allgemeinen Gleichheitssatz, wenn die Betreuungsaufwendungen des Elternteils, der das Kind nicht in seinen Haushalt aufgenommen hat, durch den Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf abgedeckt werden (sogenannter BEA-Freibetrag, im Streitjahr 2020 hat er 1.320 € betragen und heute 1.464 € pro Jahr). Die gegen dieses Urteil erhobene Verfassungsbeschwerde hat das Bundesverfassungsgericht nicht zur Entscheidung angenommen.
Durch das aktuelle BFH-Urteil zum Streitjahr 2018 hat der BFH seine Rechtsprechung bestätigt. Er hat ferner entschieden, dass er in dieser Fallkonstellation nicht von der Verfassungswidrigkeit des § 10 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 EStG ausgeht. Als verfassungsrechtlich zweifelhaft sieht der BFH die Vorschrift nur insofern an, als das Kriterium der Haushaltszugehörigkeit im Einzelfall dazu führen kann, dass über die BEA-Freibeträge hinausgehende, von den Eltern tatsächlich getragene und im Übrigen abzugsfähige Kinderbetreuungskosten bei keinem Elternteil als Sonderausgaben in Abzug gebracht werden können. Die für eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht erforderliche Überzeugung von der Verfassungswidrigkeit hat der BFH jedoch verneint. Nach wie vor gebe es gute Gründe, bei der Abzugsfähigkeit der Betreuungskosten an das Kriterium der Haushaltszugehörigkeit anzuknüpfen, weil sich die Frage externer Kinderbetreuung in erster Linie für den betreuenden Elternteil stellt, in dessen Haushalt das Kind lebt.
Ergebnis: Der BFH wies die Revision des Klägers gegen das Finanzgerichtsurteil als unbegründet zurück. Damit ist der fachbezogene Rechtsweg erschöpft, so dass der Kläger nur noch Verfassungsbeschwerde erheben kann, um die angestrebte verfassungsgerichtliche Klärung herbeizuführen.
Überlassung von Kryptowährungen: keine Kapitaleinkünfte
Das Finanzgericht Köln hat entschieden, dass Einkünfte aus dem Krypto-Lending von Bitcoins keine Kapitaleinkünfte sind und daher dem persönlichen Steuersatz unterliegen.
Praxis-Beispiel:
Der Kläger hat Einkünfte aus dem Krypto-Lending in Form von Bitcoins erzielt. Er stellte Bitcoins für einen bestimmten Zeitraum anderen Nutzern über entsprechende Plattformen darlehensweise zur Verfügung und erhielt hierfür eine zuvor festgelegte Vergütung. Das Finanzamt qualifizierte die Vergütung als sonstige Einkünfte nach § 22 Nr. 3 EStG und unterwarf sie dem persönlichen Steuersatz des Klägers. Der Kläger ist der Auffassung, dass es sich um Kapitaleinkünfte handelt, die mit dem Abgeltungssteuersatz und nicht mit dem persönlichen Steuersatz zu besteuern sind.
Kryptowerte sind keine gesetzlichen Zahlungsmittel
Das Finanzgericht Köln bestätigte die Auffassung des Finanzamts und begründete seine Entscheidung damit, dass es sich beim Krypto-Lending nicht um eine Kapitalforderung handelt, die auf die Zahlung von Geld gerichtet ist. Das Finanzgericht wies zwar darauf hin, dass Kryptowerte zunehmend als Zahlungsmittel akzeptiert werden, jedoch aktuell kein gesetzliches Zahlungsmittel darstellen. Eine bloße Ähnlichkeit zu gesetzlichen Zahlungsmitteln zwinge nach Überzeugung des Finanzgerichts nicht dazu, den Begriff der Kapitalforderung auf Kryptowährungen generell auszudehnen.
Wichtig! Das Finanzgericht hat die Revision wegen grundsätzlicher Bedeutung gemäß § 115 Abs. 2 Nr. 1 FGO zugelassen, weil bisher noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung zu der Frage vorliegt, welcher Einkunftsart Erträge aus dem Krypto-Lending zuzuordnen sind.
Fazit: In vergleichbaren Situationen sollte Einspruch eingelegt und beantragt werden, das Einspruchsverfahren ruhen zu lassen, bis der BFH über die Revision entschieden hat.
Steuertermine Februar 2026
Die folgenden Steuertermine bzw. Abgabefristen sind im kommenden Monat zu beachten.
Dabei gilt grundsätzlich: Eine Zahlung ist fristgerecht, wenn
- bei einer Überweisung der Betrag spätestens am Abgabetermin auf dem Konto des Finanzamts eingegangen ist (keine Säumniszuschläge bei Überweisung, wenn der Betrag innerhalb von 3 Tagen nach dem Termin auf dem Konto des Finanzamts eingeht = Zahlungsschonfrist; Zahlung innerhalb der Schonfrist ist dennoch eine unpünktliche Zahlung),
- bei Zahlung mit Scheck gilt die Zahlung erst 3 Tage nach Scheckeinreichung als bewirkt, auch wenn der Betrag früher beim Finanzamt gutgeschrieben wird,
- dem Finanzamt eine Einzugsermächtigung erteilt wurde; die Zahlung gilt immer als pünktlich, auch wenn das Finanzamt später abbucht.
Terminübersicht
Für den Monat Januar 2026:
| Art der Abgabe | Abgabe- und Fälligkeitstermin |
|---|---|
|
Umsatzsteuer-Voranmeldung
|
10.02.2026 |
| Zusammenfassende Meldung | 25.02.2026 |
| Sozialversicherung | 28.01.2026 |
| Lohnsteuer-Anmeldung | 10.02.2026 |
Für den Monat Februar 2026:
| Art der Abgabe | Abgabe- und Fälligkeitstermin |
|---|---|
|
Umsatzsteuer-Voranmeldung
|
10.03.2026 |
| Zusammenfassende Meldung | 25.03.2026 |
| Sozialversicherung | 26.02.2026 |
| Lohnsteuer-Anmeldung | 10.03.2026 |
Zu beachten: Die Abgabetermine entsprechen den Zahlungsterminen.
Hinweis: Der Antrag auf Dauerfristverlängerung muss nicht jährlich wiederholt werden, da die Dauerfristverlängerung solange gilt, bis der Unternehmer seinen Antrag zurücknimmt oder das Finanzamt die Fristverlängerung widerruft. Die 1/11 -Sondervorauszahlung muss dagegen von den Unternehmern, die ihre Voranmeldungen monatlich zu übermitteln haben, für jedes Kalenderjahr, für das die Dauerfristverlängerung gilt, bis zum 10. Februar berechnet, angemeldet und entrichtet werden.
Hofübergabevertrag: Lebenslanges Altenteil ist keine Schenkung
Überträgt der Ehemann dem Sohn in einem Hofübergabevertrag seinen landwirtschaftlichen Betrieb, wobei dem Ehemann und seiner Ehefrau ein lebenslanges Altenteil gewährt werden, liegt hierin keine schenkungssteuerbare Zuwendung des Ehemanns an die Ehefrau.
Praxis-Beispiel:
Mit notariellem Vertrag übertrug der Ehemann der Klägerin dem gemeinsamen Sohn seinen landwirtschaftlichen Betrieb. Der Übernehmer verpflichtete sich im Gegenzug, dem Vater und der klagenden Mutter als Gesamtberechtigte ein lebenslanges Altenteil zu gewähren. Das Altenteil umfasste das Wohnrecht an einem Haus und die Zahlung eines monatlichen Unterhaltsbetrags (Baraltenteil). Das Finanzamt war der Auffassung, dass freigebige Zuwendungen an den Ehegatten schenkungssteuerpflichtig seien. Die Klägerin sei durch die einklagbaren Geldzahlungen und durch das Recht auf unentgeltliche Nutzung der Wohnung bereichert. Die Klägerin führte aus, dass keine Schenkung im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG an sie vorlag.
Das Finanzgericht hat entschieden, dass kein schenkungssteuerbarer Sachverhalt verwirklicht wurde. Der Begriff des Altenteils bezeichnet einen Inbegriff von Rechten verschiedener Art, die durch ihre Zweckbestimmung, dem Berechtigten ganz oder teilweise für eine bestimmte Zeit oder dauernd Versorgung zu gewähren, zu einer Einheit verbunden sind. Entsprechende Verträge enthalten in der Regel die Einräumung eines Wohnungsrechts und die Gewährung von wiederkehrenden Leistungen oder Nutzungen, die aus Anlass der Übertragung eines landwirtschaftlichen Betriebs zugunsten des Übergebers oder seiner Ehefrau oder auch von nahen Familienangehörigen vereinbart werden.
Bezogen auf das Wohnrecht, das der Klägerin mit ihrem Ehemann eingeräumte wurde, mangelt es an einer freigebigen Zuwendung im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG, da bereits der objektive Tatbestand nicht erfüllt ist. Das der Klägerin eingeräumte Wohnrecht diente dazu, den Status quo der räumlich-gegenständlichen Lebensgemeinschaft mit ihrem Ehemann fortzusetzen. Die Klägerin konnte weder in rechtlicher noch in tatsächlicher Hinsicht über das Wohnrecht frei verfügen. Dies gilt auch für den der Klägerin als Baraltenteil eingeräumten Zahlungsanspruch, da sie nicht tatsächlich und rechtlich frei über die von ihr erlangte Gesamtgläubigerstellung an dem Anspruch auf Geldzahlung verfügen konnte.
Hinweis: Das Urteil des Finanzgerichts überrascht nicht, da es der Rechtsprechung des BFH zu den Voraussetzungen einer freigebigen Zuwendung an den Ehegatten folgt (Urteile vom 22.8.2007, II R 33/06 und vom 8.6.2021, II R 23/19). Eine Revision wurde daher nicht zugelassen.
Job-Ticket: Wie sich das Deutschland-Ticket (63 €-Ticket) auswirkt
Die Vergütungen, die Arbeitnehmer von ihrem Arbeitgeber zur Erstattung von Reisekosten, Umzugskosten oder Mehraufwendungen bei doppelter Haushaltsführung erhalten, sind steuerfrei, soweit sie als Werbungskosten abziehbar sind. Außerdem sind Zuschüsse steuerfrei,
- die der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Linienverkehr bzw.
- zur Nutzung des Personenfernverkehrs (ohne Luftverkehr)
- zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn leistet,
- soweit sie auf Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sowie zu einem Sammelpunkt oder einem weiträumigen Tätigkeitsgebiet entfallen.
Begünstigt sind somit Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte und alle weiteren Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr (also auch für private Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr). Der Luftverkehr ist ausdrücklich ausgeschlossen. Auch der Transport mit einem Taxi fällt nicht unter die Regelung. Der Zuschuss kann durch die kostenlose oder vergünstigte Überlassung einer Karte für öffentliche Verkehrsmittel oder durch den Zuschuss zu einer solchen Karte erfolgen.
Hinweis: Die steuerfreien Arbeitgeberleistungen mindern den Betrag, der als Entfernungspauschale abziehbar ist. Arbeitgeber sind daher verpflichtet, die gesamten nach § 3 Nr. 15 EStG steuerfreien Arbeitgeberzuschüsse im Kalenderjahr zu bescheinigen.
Pauschalierungsmöglichkeit beim Jobticket: Der Arbeitgeber hat die Wahl, auf die Steuerfreiheit des Jobtickets zu verzichten, indem er die steuerfreien Aufwendungen pauschal mit 25% versteuert. Die pauschale Besteuerung mit 25% führt dazu, dass die beim Arbeitnehmer abziehbare Entfernungspauschale nicht gemindert wird. Die pauschale Besteuerung nutzt vor allem den Arbeitnehmern, die das unentgeltliche Jobticket nicht oder nur sehr eingeschränkt nutzen können oder wollen. Damit werden eventuelle steuerliche Nachteile vermieden. Wenn die Entfernungspauschale beim Arbeitnehmer nicht gekürzt werden muss, müssen die pauschal besteuerten Bezüge auch nicht in der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung übermittelt werden. Eine individuelle Zuordnung zum einzelnen Arbeitnehmer ist ebenfalls nicht erforderlich.
Die Möglichkeit der pauschalen Besteuerung mit 25% gilt auch dann, wenn der Arbeitgeber Kosten für Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte übernimmt, die nicht steuerfrei sind, z. B. weil der Arbeitgeber die Aufwendungen nicht zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn, sondern mittels Gehaltsumwandlung übernimmt. Auch in diesen Fällen findet keine Anrechnung auf die Entfernungspauschale statt.
Kurzfristige Beschäftigung in der Landwirtschaft: Änderungen ab 2026
Unverändert gilt, dass Arbeitnehmer im Rahmen einer kurzfristigen Beschäftigung grundsätzlich für bis zu drei Monate oder 70 Arbeitstage beschäftigt werden können. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass die Tätigkeit nicht berufsmäßig ausgeübt wird.
Aber! Seit dem 1.1.2026 gibt es Änderungen für kurzfristige Beschäftigungen in der Landwirtschaft. Kurzfristig Beschäftigte in landwirtschaftlichen Betrieben können nun länger tätig sein. Die Zeitgrenzen für kurzfristige Beschäftigungen in landwirtschaftlichen Betrieben sind auf 15 Wochen oder 90 Arbeitstage pro Kalenderjahr ausgeweitet worden. Die verlängerten Zeitgrenzen sollen dazu dienen, die Personalsituation zum Beispiel in der Erntezeit zu verbessern.
Arbeitgeber, die von der Ausweitung der Zeitgrenzen profitieren
Die neue Regelung betrifft ausschließlich landwirtschaftliche Betriebe im Sinne der aktuellen Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statistischen Bundesamtes. Folgende Wirtschaftszweige fallen darunter:
- Anbau ein- und zweijähriger Pflanzen
- Anbau mehrjähriger Pflanzen
- Betrieb von Baumschulen und Anbau von Pflanzen zu Vermehrungszwecken
- Tierhaltung
- Gemischte Landwirtschaft
- Erbringung landwirtschaftlicher Dienstleistungen und nach der Ernte anfallende Tätigkeiten
Für sogenannte Mischbetriebe gilt folgendes: Als Mischbetriebe werden Betriebe bezeichnet, die nicht ausschließlich in einem Wirtschaftsbereich tätig sind. Sind landwirtschaftliche Betriebe nicht ausschließlich in den oben genannten Wirtschaftsbereichen tätig, kommt es für die Frage, ob die erweiterten Zeitgrenzen gelten, auf den Schwerpunkt des Betriebes an. Dieser wird über die Anzahl der Beschäftigten definiert. Für Mischbetriebe gilt:
- Ist die Mehrzahl der Arbeitnehmer in der Landwirtschaft tätig, gilt der gesamte Betrieb als landwirtschaftlicher Betrieb. Dann profitieren alle kurzfristig Beschäftigten von den erweiterten Zeitgrenzen.
- Anderenfalls zählt der Mischbetrieb nicht als landwirtschaftlicher Betrieb und die üblichen Zeitgrenzen von drei Monaten oder 70 Arbeitstagen finden Anwendung. Dies gilt dann auch für die Arbeitnehmer, die tatsächlich landwirtschaftliche Arbeiten erledigen.
Die Beurteilung der Zugehörigkeit zu einem landwirtschaftlichen Betrieb im Sinne dieser Regelung obliegt dem Arbeitgeber im Rahmen seiner Aufgabe, die Versicherungspflicht seiner Mitarbeiter zu klären und sie den Sozialversicherungsträgern korrekt zu melden.
Worauf Landwirte ab 2026 achten müssen: Arbeitgeber müssen sorgfältig prüfen, ob ihr Betrieb als landwirtschaftlicher Betrieb einzustufen ist. Falls ja, gelten für kurzfristige Beschäftigungen die erweiterten Zeitgrenzen von 15 Wochen oder 90 Arbeitstagen.
Überprüfung der Zeitgrenzen bei mehreren kurzfristigen Beschäftigungen
Bisher waren bei der Zusammenrechnung mehrerer kurzfristiger Beschäftigungen für alle Arbeitgeber 3 Monate (90 Kalendertage) oder 70 Arbeitstage maßgebend. Ab 2026 gilt für landwirtschaftliche Betriebe eine Dauer von 15 Wochen (105 Kalendertagen) oder 90 Arbeitstagen.
Fazit: Ab 2026 dürfen kurzfristige Beschäftigungen in landwirtschaftlichen Betrieben länger dauern, was insbesondere zur Verbesserung der Personalsituation zum Beispiel in der Erntezeit beiträgt. Arbeitgeber müssen sicherstellen, dass ihr Betrieb zur Landwirtschaft gehört und die neuen Zeitgrenzen korrekt anwenden.
Unfall mit einem Firmenwagen auf einer privaten oder betrieblichen Fahrt
Aus ertragsteuerlicher Sicht teilen Unfallkosten das Schicksal der Fahrt oder Reise, bei der sich der Unfall ereignet hat. Findet der Unfall auf einer privaten Fahrt statt, sind die Kosten, soweit sie nicht von einer Versicherung abgedeckt werden, ohne Gewinnauswirkung zu buchen. Bei einem Unfall auf einer betrieblichen Fahrt, sind die mit dem Unfall zusammenhängenden Kosten den betrieblichen Kfz-Kosten zuzurechnen. Im Gegensatz hierzu sind bei der Umsatzsteuer die Unfallkosten anteilmäßig zu erfassen.
Abgrenzung: Wann Fahrten mit dem Firmen-PKW dem privaten Bereich zugeordnet werden
Da bei einem Verkehrsunfall die Unfallkosten das Schicksal der Fahrtkosten teilen, kommt es darauf an, die jeweilige Fahrt dem betrieblichen oder privaten Bereich zuzuordnen. Das heißt, dass die Kosten privat veranlasst sind, wenn die Fahrt privat veranlasst war (Vorsicht: Eine betriebliche Fahrt wird zu einer privaten Fahrt, wenn der Unternehmer z. B. an einem Wettrennen im öffentlichen Straßenverkehr teilnimmt oder alkoholbedingt fahruntüchtig ist.)
Fahrten sind und bleiben betrieblich, auch wenn eine untergeordnete private Mitveranlassung vorliegt. Das ist z. B. der Fall, wenn der Unternehmer auf einer beruflich veranlassten Fahrt einen Bekannten aus privaten Gründen mitnimmt. Wegen der untergeordneten privaten Mitveranlassung sind alle Kosten als Betriebsausgaben abziehbar. Entstehen jedoch aus dieser privaten Mitveranlassung erhebliche Kosten, können diese nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden. Das ist z. B. der Fall, wenn der Unternehmer aufgrund eines Unfalls seinem privaten Mitfahrer Schadensersatz leisten muss (BFH-Urteil vom 1.12.2005, IV R 26/04). Zahlungen an den geschädigten Mitfahrer sind keine Betriebsausgaben.
Beurteilung von Unfallkosten
Nach dem BFH-Urteil vom 18.4.2007 (XI R 60/04) gilt eine einheitliche Linie, die sowohl von den Finanzgerichten als auch von der Finanzverwaltung vertreten wird. Es kann von Folgendem ausgegangen werden:
- Ein PKW, der zum Betriebsvermögen gehört, ist und bleibt Betriebsvermögen, auch wenn der Unternehmer seinen Firmen-PKW für private Fahrten nutzt.
- Bei einer privaten Fahrt dürfen die Aufwendungen, die über die Erstattung der Versicherung hinausgehen, nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden; bei einer betrieblichen Fahrt sind die Aufwendungen gewinnmindernd abziehbar.
- Tritt bei einem Unfall auf einer betrieblichen Fahrt ein Totalschaden ein, ist der Buchwert des PKW als Betriebsausgabe zu buchen. Zahlungen für den zerstörten PKW und Erstattungen von einer Versicherung werden als Betriebseinnahmen erfasst.
- Tritt bei einem Unfall auf einer privaten Fahrt ein Totalschaden ein, liegt gemäß in Höhe des Restbuchwerts eine Nutzungsentnahme vor (R 4.7 Abs. 1 EStR). Zahlungen einer Versicherung sind als Betriebseinnahmen zu erfassen, soweit der Betrag über den Restbuchwert hinausgeht.
- Ist der Unternehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt, kann er die Vorsteuer immer in vollem Umfang geltend machen, auch wenn sich der Unfall auf einer privaten Fahrt ereignet hat.
Unfallkosten werden ertragsteuerlich und umsatzsteuerlich teilweise unterschiedlich behandelt. Die Auswirkungen hängen insbesondere davon ab, ob die eigene Versicherung oder die Versicherung des Unfallgegners für den Schaden aufkommt. Problematisch ist es für den Unternehmer, wenn die Haftpflichtversicherung des Unfallgegners oder die eigene Vollkaskoversicherung keinen Ersatz leistet.
Auswirkungen bei einem Unfall mit Totalschaden: Es werden keine stillen Reserven realisiert, wenn der Firmen-PKW eines Unternehmers während einer privaten Fahrt zerstört wird. Das heißt, der Unfall auf einer privaten Fahrt führt nicht zu einer Gewinnrealisierung. Vielmehr liegt in Höhe des Buchwerts eine Nutzungsentnahme vor. Schadenersatzforderungen für den zerstörten PKW sind als Betriebseinnahmen zu erfassen, soweit sie über den Buchwert hinausgehen.
Eine Kaskoversicherung, die der Unternehmer abschließt, deckt sowohl die Risiken auf betrieblichen als auch auf privaten Fahrten ab. Die Zahlung einer Kaskoversicherung ist in vollem Umfang als Betriebseinnahme zu erfassen, wenn der Firmen-PKW während einer betrieblichen Nutzung gestohlen wurde. Ist der Firmen-PKW während einer privaten Nutzung gestohlen worden, liegt in Höhe des Buchwerts eine Nutzungsentnahme vor. Zahlungen der Kaskoversicherung sind als Betriebseinnahmen zu erfassen, soweit sie über den Buchwert hinausgehen.
Minijob: Befreiung von der Rentenversicherungspflicht kann widerrufen werden
Minijobber sind grundsätzlich versicherungspflichtig in der gesetzlichen Rentenversicherung. Sie zahlen grundsätzlich bei einer Beschäftigung im gewerblichen Bereich einen Eigenanteil in Höhe von 3,6 % des Verdienstes (13,6 % bei einer Beschäftigung im Privathaushalt). Beschäftigte können auf die Zahlung des Eigenanteils auch verzichten. Sie verzichten damit aber auch auf vollwertige Leistungsansprüche in der Rentenversicherung. Dafür stellen sie einen Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht bei ihrem Arbeitgeber.
Bisher galt: Die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht gilt für die gesamte Dauer des Minijobs. Sie konnte nicht widerrufen werden. Aber! Ab dem 1.7.2026 können Minijobber die Befreiung nun einmalig wieder rückgängig machen. Das bedeutet, dass Minijobber dann wieder rentenversicherungspflichtig sind und zusätzlich zu den Beiträgen des Arbeitgebers eigene Beiträge zur Rentenversicherung zahlen. So erwerben sie weitere Ansprüche in der Rentenversicherung.
Voraussetzungen und Fristen für die Aufhebung der Befreiung
Minijobber müssen die Aufhebung der Befreiung bei ihrem Arbeitgeber schriftlich oder elektronisch beantragen. Arbeitgeber müssen den Eingang des Antrags dokumentieren und die Änderung in den Entgeltunterlagen festhalten. Ebenso melden sie die Aufhebung der Befreiung an die Minijob-Zentrale. Die Befreiung gilt als aufgehoben, wenn die Minijob-Zentrale nicht innerhalb eines Monats nach Eingang der Meldung widerspricht. Die Aufhebung der Befreiung wirkt ab dem Monat, der auf den Monat der Antragstellung folgt. Sie gilt nur für die Zukunft. Eine rückwirkende Aufhebung ist nicht möglich.
Praxis-Beispiel:
Ein Minijobber hat sich zu Beginn seines Minijobs von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen. Nun beantragt er die Aufhebung der Befreiung bei seinem Arbeitgeber. Der Antrag geht am 20.9. beim Arbeitgeber ein. Der Arbeitgeber muss den Antrag auf Aufhebung der Befreiung mit dem Eingangsdatum in den Entgeltunterlagen des Minijobbers dokumentieren.
Der Arbeitgeber informiert die Minijob-Zentrale wie folgt:
- Der Arbeitgeber meldet den Minijob (Beitragsgruppe „5 – Pauschalbeitrag zur Rentenversicherung“ mit dem Abgabegrund „32 – Abmeldung wegen Beitragsgruppenwechsel“) zum 30. September ab.
- Anschließend meldet er den Minijob zum 1. Oktober (Beitragsgruppe „1 – voller Beitrag bei Versicherungspflicht in der Rentenversicherung“ mit dem Abgabegrund „12 – Anmeldung wegen Beitragsgruppenwechsel“) wieder an.
Ab dem 1. Oktober ist der Minijobber wieder rentenversicherungspflichtig und zahlt den Eigenanteil zur Rentenversicherung. Ab diesem Zeitpunkt sind auch die Beitragsnachweise entsprechend anzupassen.
Worauf bei der Aufhebung der Befreiung zu achten ist
Folgende Punkte sollten Arbeitgeber und Arbeitnehmer beachten:
- Dauer der Wirksamkeit: Die Aufhebung der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht gilt für die gesamte Dauer des Minijobs. Ein Widerruf der Aufhebung ist nicht möglich.
- Regelung für mehrere Minijobs: Haben Beschäftigte mehrere Minijobs mit Verdienstgrenze, kann die Aufhebung der Befreiung nur einheitlich erfolgen. Das heißt: Die Aufhebung der Befreiung gilt für alle Beschäftigungen. Arbeitgeber müssen der Minijob-Zentrale den Wechsel der Beitragsgruppe melden.
- Minijob und Altersvollrente: Minijobber, die nach Erreichen der Regelaltersgrenze bereits eine Vollrente wegen Alters beziehen, sind vom Gesetz her rentenversicherungsfrei. Eine Aufhebung der Befreiung ginge somit ins Leere. Sie können jedoch auf diese Rentenversicherungsfreiheit verzichten und sich für die Zahlung ihres Beitragsanteils zur Rentenversicherung entscheiden.
- Berufsständische Versorgungseinrichtungen: Auch Minijobber, die einer berufsständischen Versorgungseinrichtung angehören, können die Aufhebung der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht beantragen.
Fazit: Die Aufhebung der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht bietet Minijobbern mehr Flexibilität in der Entscheidung, ob sie in die Rentenversicherung einzahlen möchten oder nicht. Arbeitgeber müssen die Aufhebung der Befreiung an die Minijob-Zentrale melden.
Vorsteuerabzug: Nachträglich eingebaute Bestandteile
Für ein Fahrzeug, das ohne Vorsteuerabzug eingekauft wurde, kann es keine Vorsteuerkorrektur geben. Allerdings gibt es für nachträglich eingebaute Bestandteile einen eigenen Berichtigungszeitraum. Gemäß § 15a Abs. 3 UStG kann eine Berichtigung der Vorsteuer auch dann in Betracht kommen, wenn
- ein Wirtschaftsgut in ein anderes Wirtschaftsgut eingeht oder
- an einem Wirtschaftsgut eine sonstige Leistung ausgeführt wird.
Mehrere Einbauten und sonstige Leistungen werden zu einem Berichtigungsobjekt zusammengefasst, wenn sie “im Rahmen einer Maßnahme” ausgeführt werden.
Praxis-Tipp
Nach § 44 Abs. 1 UStDV findet eine Berichtigung des Vorsteuerabzugs jedoch nur dann statt, wenn die Vorsteuer, die auf die Anschaffungskosten des eingebauten Wirtschaftsguts entfällt, mehr als 1.000 € beträgt. Zunächst ist jeder Gegenstand bzw. Bestandteil und jede sonstige Leistung für sich zu beurteilen. Werden aber gleichzeitig mehrere Bestandteile eingebaut und sonstige Leistungen erbracht, dann sind diese zu einer Maßnahme zusammenzufassen, sodass die Bagatellgrenze wesentlich schneller überschritten wird.
Praxis-Beispiel:
Ein Unternehmer hat im Jahr 2025 einen gebrauchten Pkw erworben, bei dem der Vorsteuerabzug nicht möglich war. Im Januar 2026 lässt er in seinen Pkw einen Austauschmotor für 5.000 € zuzüglich 950 € Umsatzsteuer und gleichzeitig ein fest installiertes Navigationssystem für 2.500 € zuzüglich 475 € Umsatzsteuer einbauen.
Die Umsatzsteuer aus diesen Vorgängen in Höhe von (950 € + 475 € =) 1.425 € macht er als Vorsteuer geltend. Er entnimmt das Fahrzeug zum 31.12.2026 mit dem Teilwert von 8.000 € aus dem Betriebsvermögen. Da die Bagatellgrenze überschritten wird, ist eine Vorsteuerkorrektur vorzunehmen. Von dem 5-jährigen Korrekturzeitraum ist am 31.12.2026 erst 1 Jahr (= 1/5) abgelaufen. Die Vorsteuer ist daher in Höhe von 4/5 zu korrigieren (1.425 € : 5 = 285 € × 4 = 1.140 €).
Aufwendungen für Sponsoring als Betriebsausgaben
Das Finanzgericht Hamburg hat entschieden, dass die von einer GmbH getätigten Sponsoringaufwendungen an einen gemeinnützigen Verein als vollständig abzugsfähige Betriebsausgaben anzuerkennen sind und nicht als Spenden gelten.
Das Gericht stützte sich dabei auf die Tatsache, dass der Verein eine Gegenleistung in Form von Öffentlichkeitsarbeit und der Erlaubnis erbrachte, das Sponsoring zu Werbezwecken zu nutzen. Dieses Urteil unterstreicht, dass diese Aufwendungen auf geschäftliche Vorteile wie Imageverbesserung und Marktpositionierung abzielten und kein reiner Selbstzweck waren.
Darüber hinaus kam das Finanzgericht zu dem Schluss, dass die vereinbarten Zahlungsmodalitäten und Zinssätze keine „verdeckte Gewinnausschüttung“ darstellen. Die vereinfachte Zahlungsstruktur entsprach den gemeinnützigen und aufbauenden Zielen des Vereins. Die steuerlichen Einwände der Finanzbehörde gegen die Ausgestaltung des Sponsoringvertrags wurden somit zurückgewiesen. Abschließend wurde festgestellt, dass auch der Vorsteuerabzug aus den Sponsoringaufwendungen rechtmäßig ist, weil der Verein wirtschaftlich relevante Gegenleistungen erbracht hat.
Doppelte Haushaltsführung: Nutzung eines Wohnmobils
Das Finanzgericht hat es abgelehnt, ein Wohnmobil als Zweitwohnung im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung steuerlich anzuerkennen, wenn das Wohnmobil auch für Fahrten zwischen der Hauptwohnung und erster Tätigkeitstätte genutzt wird.
Praxis-Beispiel:
Der Kläger argumentierte, dass das Wohnmobil die Mindestanforderungen für eine Wohnung am Arbeitsplatz erfülle, da es über eine konstante Platzierung sowie vollständige Wohnfunktionen wie Schlaf-, Koch- und Sanitärbereiche verfüge. Der Einkommensteuerbescheid verweigerte jedoch die Anerkennung der doppelten Haushaltsführung mit der Begründung, dass das Wohnmobil sowohl für Wohn- als auch für Reisezwecke genutzt wurde, wodurch die notwendige dauerhafte Trennung zwischen Haupt- und Zweitwohnung nicht gegeben sei.
Das Finanzgericht Baden-Württemberg urteilte, dass ein Wohnmobil zwar grundsätzlich als Unterkunft gelten kann, aber die tatsächliche Nutzung entscheidend ist. In diesem Fall wurde das Wohnmobil regelmäßig für wöchentliche Familienheimfahrten genutzt, wodurch die erforderliche räumliche und funktionale Trennung zwischen Haupt- und Zweitwohnung aufgehoben wurde. Dies führte dazu, dass keine „dauerhafte Wohnung“ am Beschäftigungsort im Sinne des Gesetzes vorlag. Folglich wurde der Anspruch auf doppelte Haushaltsführung abgelehnt. Allerdings wurden die Fahrtkosten zum Arbeitsplatz teilweise als absetzbare Werbungskosten anerkannt. Eine Revision des Urteils wurde nicht zugelassen.
Steuerliche Behandlung von Parkplatz-Überlassung an Arbeitnehmer
Sachzuwendungen sind als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu erfassen, wenn der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer einen Vorteil zuwendet, der durch das individuelle Dienstverhältnis veranlasst ist. Es muss sich also um einen Vorteil handeln, bei dem es sich um eine Gegenleistung für das Zurverfügungstellen der individuellen Arbeitskraft des Arbeitnehmers handelt. Bei einer Zuwendung an den Arbeitnehmer, die aufgrund anderer Rechtsbeziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bewirkt wird, liegt kein Arbeitslohn vor. Auch Vorteile, die im ganz überwiegenden eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers gewährt werden, stellen mangels Entlohnungscharakter keinen Arbeitslohn dar.
Von einem eigenständigen Nutzungsverhältnis ist z. B. auszugehen, wenn der Arbeitgeber ein „Garagengeld“ zahlt, damit der Arbeitnehmer den überlassenen Firmenwagen in seiner eigenen Garage unterstellt. Der Arbeitgeber will damit Risiken und Nachteile, die mit dem Abstellen im Freien verbunden sind (Beschädigung, Diebstahl, höhere Versicherungsprämien), ausschließen. Fazit: Der Arbeitgeber verfolgt mit der Zahlung eines „Garagengeldes“ ein überwiegend eigenbetriebliches Interesse, sodass kein Arbeitslohn vorliegt.
Konsequenz: Die Überlassung eines Parkplatzes an einen Arbeitnehmer kann unterschiedlich motiviert sein, sodass die Kosten, die der Arbeitgeber übernimmt – je nach Situation – steuerlich unterschiedlich zu beurteilen sind:
- Überlassung unentgeltlicher Parkplätze am Firmensitz bzw. an der ersten Tätigkeitsstätte = Nutzungsüberlassung stellt keinen Arbeitslohn dar.
- Erstattung der Parkgebühren für öffentliche Parkplätze oder Parkhäuser in der Nähe der ersten Tätigkeitsstätte = es liegt insoweit steuerpflichtiger Arbeitslohn vor.
- Arbeitgeber mietet öffentliche Parkplätze oder Stellplätze in einem Parkhaus in der Nähe der ersten Tätigkeitsstätte an, um diese seinen Arbeitnehmern kostenlos zu überlassen = es liegt in der Regel kein steuerpflichtiger Arbeitslohn vor.
- Erstattung der Parkgebühren bei beruflichen Auswärtstätigkeiten des Arbeitnehmers = die erstatteten Beträge nach § 3 Nr. 16 EstG sind steuerfrei.
- Erstattung von Parkgebühren bei Privatfahrten des Arbeitnehmers = es liegt steuerpflichtiger Arbeitslohn vor (das gilt auch bei der Nutzung eines Firmenwagens, weil die Parkgebühren nicht durch den Ansatz der 1%-Regelung abgegolten sind).
- Zahlung eines „Garagengeldes“ durch den Arbeitgeber für die Unterbringung eines arbeitnehmereigenen Fahrzeugs = es handelt sich um steuerpflichtigen Arbeitslohn.
- Arbeitnehmer vermietet seinem Arbeitgeber die eigene Garage, damit der Dienstwagen dort untergestellt wird = es handelt sich um Zahlungen, die der Arbeitgeber aufgrund eines Mietvertrags zahlt, sodass es sich nicht um Arbeitslohn, sondern um Mietzahlungen i.S. des § 21 Abs. 1 EStG handelt.
- Arbeitnehmer mietet die Garage von einem Dritten, um darin den Firmenwagen unterzustellen; der Arbeitgeber erstattet seinem Arbeitnehmer diese Mietkosten = es handelt sich um steuerfreien Auslagenersatz und nicht um Arbeitslohn.
Hinweis: Trägt der Arbeitnehmer die Parkgebühren für das Abstellen seines Fahrzeugs während der Arbeitszeit selbst, sind die Kosten durch den Ansatz der Entfernungspauschale abgegolten.
Stellplatzkosten: Keine Minderung des geldwerten Vorteils
Kosten für einen Stellplatz, die der Arbeitnehmer selbst trägt, mindern nicht den geldwerten Vorteil, der ihm aus der unentgeltlichen Kfz-Überlassung für Privatfahrten zufließt.
Praxis-Beispiel:
Die Klägerin überlässt ihren Arbeitnehmern Firmenwagen auch zur privaten Nutzung. Kosten der Arbeitnehmer für das Anmieten von Garagen- und Einstellplätzen übernimmt sie gemäß der betrieblichen “Firmenwagenregelung” nicht. Da aber im Umfeld der Büroräume der Klägerin öffentliche Parkplätze nur in geringer Anzahl zur Verfügung stehen, bietet sie ihren Arbeitnehmern (unabhängig davon, ob diese einen Firmenwagen oder ein privates Fahrzeug nutzen) die Möglichkeit an, in der Nähe der Tätigkeitsstätte bei ihr einen Parkplatz zu einem monatlichen Entgelt von 30 € anzumieten.
Den geldwerten Vorteil aus der Nutzungsüberlassung des Firmenwagens ermittelte die Klägerin unter Anwendung der 1%-Regelung und der 0,03%-Regelung für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. Sofern Mitarbeiter einen Parkplatz von ihr anmieteten, berücksichtigte sie die monatlichen Mietzahlungen der Arbeitnehmer, indem sie den geldwerten Vorteil entsprechend minderte. Das Finanzamt war der Ansicht, dass der Wert des geldwerten Vorteils aus der Nutzungsüberlassung nicht um die Stellplatzmiete gemindert werden darf, da diese Aufwendungen nicht zu den Gesamtkosten des Fahrzeugs gehören. Das Finanzamt erließ daher einen Nachforderungsbescheid über Lohnsteuer und sonstige Lohnsteuerbeträge.
Der BFH hat entschieden, dass die von den Arbeitnehmern getragenen Stellplatzkosten zu Unrecht bei der Bemessung des geldwerten Vorteils aus der Nutzungsüberlassung der betrieblichen Kfz vorteilsmindernd berücksichtigt wurden. Die unentgeltliche Überlassung eines Stellplatzes oder einer Garage tritt als eigenständiger Vorteil neben den Vorteil für die Nutzung eines betrieblichen Kfz zu privaten Fahrten.
Zu den Aufwendungen für die Nutzung des Kfz zählen neben den Leistungen, die von der Fahrleistung abhängig sind, wie z. B. Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe, auch regelmäßig wiederkehrende feste Kosten. Kosten, die wie z. B. Fähr-, Maut- oder Vignettenkosten für Privatfahrten ausschließlich von der Entscheidung des Arbeitnehmers abhängen, mit dem Fahrzeug ein bestimmtes privates Ziel aufzusuchen, gehören nicht hierzu. Die Übernahme solcher Kosten durch den Arbeitgeber begründet vielmehr einen eigenständigen geldwerten Vorteil.
Entsprechendes gilt im Hinblick auf Stellplatz- und Garagenkosten. Denn auch die unentgeltliche Überlassung eines Stellplatzes oder einer Garage stellt, soweit die Überlassung nicht aus eigenbetrieblichen Interessen des Arbeitgebers erfolgt, einen eigenständigen Vorteil dar, der nicht nach der 1%-Regelung oder nach der Fahrtenbuchmethode, sondern als eigenständiger Vorteil zu bewerten ist.
Fazit: Trägt der Arbeitnehmer Kosten für einen Stellplatz oder eine Garage, kann dies daher nur zu einer Minderung des Vorteils führen, der ihm durch die Überlassung des Stellplatzes beziehungsweise der Garage zugewandt wurde. Eine Vorteilsminderung im Hinblick auf die Kfz-Überlassung scheidet dagegen aus.